 Freitag, 13. Februar 2026, 19 – 22 Uhr
Freitag, 13. Februar 2026, 19 – 22 Uhr
“I Object” – Kriegsdienstverweigerung als Widerstand gegen Staat und Militär
Am Kriegsdienst zeigt sich letztendlich, ob eine Gesellschaft bereit ist, die Kriegspläne ihrer
Regierungen und Militärs in die Tat umzusetzen, oder nicht. Deutschland unterstützt
kriegführende Staaten, in denen diese Bereitschaft auf die Probe gestellt wird – v.a. die
Ukraine und Israel. Ob die Kriegführung – und die deutsche Unterstützung derselben – im
Sinne der ukrainischen oder israelischen Gesellschaft geschieht, zeigt sich vielleicht am
deutlichsten an der jeweiligen Verbreitung der Kriegsdienstverweigerung in diesen Ländern.
Und wie steht es überhaupt um die Kriegsbereitschaft der deutschen Bevölkerung?
Auf der Internationalen Münchner Friedenskonferenz 2026 (IMFK26) werden wir die
vielfältigen Bedeutungen und Möglichkeiten der Kriegsdienstverweigerung erkunden.
Hintergründe
Ukraine
Dass die ukrainische Kriegführung im Sinne der ukrainischen Gesellschaft geschieht, kann
zumindest angezweifelt werden. Die verwüsteten Landschaften, zerbombten Städte und
hunderttausenden Verletzten und Ermordeten sprechen dagegen – werden jedoch meist nicht
mit der eigenen militärischen Verteidigung assoziiert, sondern alleine mit dem russischen
militärischen Überfall. Doch die Millionen ukrainischer Männer, die sich dem Kriegsdienst
entziehen, deuten darauf hin, dass auch die eigene militärische Verteidigung nicht mehr in
ihrem Sinne stattfindet. Zeigt sich hier die Erkenntnis, dass die militärische Verteidigung nicht
dem Schutz des eigenen Lebens dient, sondern dem Erhalt des ukrainischen Staates?
Israel
Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben bisher kein ausgeprägtes
Rekrutierungs- bzw. Einberufungsproblem. Doch mit der Ankündigung immer weiterer
Kampagnen in Gaza regt sich Widerstand in der IDF und unter den Reservist*innen. Die IDF
warnen, dass die Streitkräfte erschöpft seien; die Netanjahu-Regierung riskiert den
gesellschaftlichen Rückhalt für den Krieg, indem sie immer mehr Menschen in die
Hoffnungslosigkeit hineinzieht, die sie in Gaza kreiert hat. Zusätzlicher Druck entsteht durch
die internationale Verurteilung des Krieges, der u.a. als ethnische Säuberung oder Genozid
charakterisiert wird – und nicht zuletzt durch die unermüdliche Aufklärungsarbeit von
palästinensischen und israelischen Kriegsgegner*innen und Kriegsdienstverweiger*innen wie
Breaking the Silence und Combatants for Peace.
Deutschland
Für die deutsche Unterstützung der Kriegführung macht es kaum einen Unterschied – die
Bundesregierung befragt ukrainische Reservisten nicht dazu, ob sie mit einem deutschen
Sturmgewehr in der Hand an der Front sterben möchten. Doch was passiert, wenn die
deutsche Gesellschaft die Kriegsvorbereitung der eigenen Regierung nicht mitträgt?
In Sachen Kriegsvorbereitung hatte die deutsche Politik lange Zeit quasi freie Hand. Alle
staatstragenden bzw. regierungsfähigen Parteien teilen per Definition das Anliegen der
Aufrüstung. Aufrüstung kann also nicht abgewählt werden – sofern sie überhaupt zur Wahl
steht.
Ein Abriss relevanter Belege: Wahlversprechen zur Begrenzung von
Rüstungsambitionen werden links und rechts gebrochen (“Keine Waffen und Rüstungsgüter
in Kriegsgebiete!”; “Ich schließe eine […] Aufweichung der Schuldenbremse […] aus.”). Andere
Entscheidungen stehen gar nicht erst zur Debatte (“Sondervermögen für die Bundeswehr”;
Stationierung atomwaffenfähiger US-Mittelstreckenraketen in Deutschland). Breite Mehrheiten
gegen den Verbleib von US-Atombomben in Deutschland sowie gegen Auslandseinsätze der
Bundeswehr, die über Jahrzehnte in Umfragen zutage kommen, bleiben folgenlos.
Wenn aber der deutsche Verteidigungsminister sich vornimmt, die Größe des Militärs mehr als
zu verdoppeln (von ca. 182.000 aktiven Soldat*innen und 34.000 Reservist*innen auf 260.000
aktive Soldat*innen und 200.000 Reservist*innen), dann hat die Gesellschaft etwas
mitzureden. Da genügt keine passive Hinnahme von Wortbruch und Missachtung des
Wählerwillens. Ausreichend deutsche Staatsbürger*innen müssen sich aktiv dafür
entscheiden, Kriegsdienst zu leisten. Bisher passiert das Gegenteil; das Militär schrumpft, trotz
eines jährlichen Werbebudgets von über 50 Millionen Euro und trotz der Rekrutierung
tausender Kindersoldat*innen.
Gleichzeitig steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung nach Art. 4 Abs. 3 GG deutlich an. Die notwendige Konsequenz ist der Zwang zum Kriegsdienst, der mit dem Neuaufguss der “Wehrpflicht” bereits angekündigt wurde. Wie wird die gesellschaftliche Reaktion auf diesen Zwang ausfallen?
Kriegsdienstverweigerung
Wie sich in der Ukraine, Israel und Deutschland zeigt, trägt die Kriegsdienstverweigerung
vielfältige Bedeutungen und Möglichkeiten in sich:
● Kriegsdienstverweigerung als Überlebensmaßnahme
● Kriegsdienstverweigerung als Verbrechensbekämpfungsmaßnahme
● Kriegsdienstverweigerung als Konfliktpräventionsmaßnahme
In jedem Fall bedeutet sie eines: Kriegsdienstverweigerung als Widerstand gegen Staat
und Militär.
Relevanz für die Münchner Friedenskonferenz 2026
Die transnationale Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren ist ein
Thema, das die deutsche Friedensbewegung energetisiert und das sowohl für den derzeitigen
Diskurs als auch die Realität in Kriegs- und Konfliktgebieten unmittelbar relevant ist.
Die Relevanz für den Diskurs in Deutschland ergibt sich aus der andauernden
Wehrpflicht/Kriegsdienst/Dienstpflicht-Debatte sowie der Einschränkungen des Asylrechts und
der Präsenz hunderttausender ausländischer Kriegsdienstverweigerer in Deutschland (z.B.
aus der Ukraine und der Türkei).
Die Relevanz für die Realität in Kriegs- und Konfliktgebieten liegt ebenfalls nahe.
Kriegsdienstgegner*innen, insbesondere Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, werden
weltweit marginalisiert und kriminalisiert. Gleichzeitig wüten immer mehr bewaffnete Konflikte
und Kriege. Vielerorts werden Menschen zum Kriegsdienst mit der Waffe genötigt und/oder
gezwungen.
Für die Internationale Münchner Friedenskonferenz ist die Kriegsdienstverweigerung damit ein
ideales Thema. Die Relevanz ist sowohl für das heimische als auch das internationale
Publikum gegeben. Mit der Kriegsdienstverweigerung bieten wir zudem ein Thema, das für
Medien aller Art (traditionelle Medien, social media, etc.) unmittelbar ansprechend und
menschlich darstellbar ist. Egal, welche (geo)politischen Veränderungen sich noch vor der
IMFK26 abspielen, Kriegsdienstverweigerung wird unweigerlich ein relevantes Thema sein.
Die Kriegsdienstverweigerung bildet zudem einen idealen Gegenpol zur Sicherheitskonferenz.
Während bei der Sicherheitskonferenz Militär-, Politik- und Wirtschaftseliten beabsichtigen,
über das Schicksal von mehr oder weniger machtlosen Bevölkerung und Gesellschaft zu
entscheiden, nehmen eben diese vermeintlich machtlosen Menschen mit der
Kriegsdienstverweigerung ihr Schicksal selbst in die Hand.
Format
Zentrales Element des Abendprogramms ist ein Podium bestehend aus KDV
Verbänden/Vereinen/Organisationen/Initiativen/Persönlichkeiten aus Deutschland sowie aus
Ländern, in denen Kriege stattfinden, an denen Deutschland und seine NATO-Partner sich
beteiligen.
Die Podiumsteilnehmer*innen sollten dabei im Speziellen auf folgende Themen eingehen:
● Gibt es eine rechtliche Grundlage für die Kriegsdienstverweigerung in ihrem Land und
wenn ja, welche?
● Wird das Recht auf Kriegsdienstverweigerung in der Praxis gewährt? Wie ergeht es
Soldaten, Kriegsdienstverweigerern, Deserteuren?
● Welche Möglichkeiten gibt es zur Stärkung der Stellung der Kriegsdienstverweigerer
durch internationale Solidarität/Kooperation?
● Was bedeutet Kriegsdienstverweigerung im Kontext von Aufrüstung,
Völkerrechtsbrüchen und der Automatisierung der Kriegsführung?
Um dem Programm eine Dynamik zu geben, sollte die Moderation auch Fragen aufwerfen,
die die Gegner*innen von Kriegsdienstverweigerung typischerweise umtreiben, z.B.:
● Warum sollte man sein Land/seine Gesellschaft nicht gegen einen
völkerrechtswidrigen Angriff oder eine völkerrechtswidrige Okkupation verteidigen?
● Ist der Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung nicht ein Aufruf zur Kapitulation?
● Was sind die Alternativen zur militärischen Verteidigung? etc.
Im Vorhinein könnte eine gemeinsame Resolution erarbeitet werden, die bspw. die auf der
Sicherheitskonferenz versammelten Regierungs- und Staatsoberhäupter dazu auffordert, das
Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung anzuerkennen und zu respektieren. Die
Resolution wird dann zum Abschluss des Abends vorgestellt und veröffentlicht.
Gäste/Referent*innen
KDV-Verbänden/Vereinen/Organisationen/Initiativen/Persönlichkeiten
● aus Deutschland
○ Organisationen, z.B.: Connection e.V., DFG-VK
○ Simon David Dressler
● Palästina/Israel
○ Organisationen, z.B.: Breaking the Silence, Combatants for Peace, Mesarvot
○ Sofia Orr (angefragt)
● Ukraine/Russland
○ Organisationen, z.B.: die Russische Bewegung der Kriegsdienstverweigerer,
die Ukrainische Pazifistische Bewegung
○ Timofey Vaskin (angefragt)
Internationale Münchner Friedenskonferenz 2026
Freitag, 13. Februar 2026, 19 – 21:30 Uhr

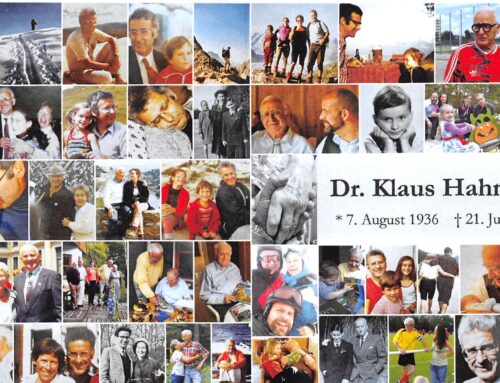

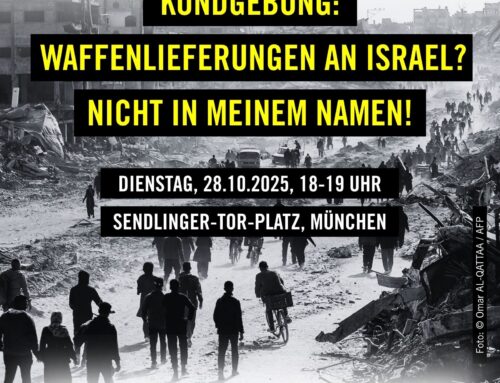

Hinterlasse einen Kommentar